| DAS ORIGINAL
Bei den 300 SLS-Fahrzeugen,
die wir heutzutage
auf Oldtimer-Rallyes, -ausstellungen u.s.w. sehen, handelt es sich samt
und sonders um privat umgerüstete Serien-Roadster, daher kommen
auch
die verschiedenen Erscheinungsbilder mit und ohne
Überrollbügel,
z.T. ohne Chromzierrat, mit den unterschiedlichsten Felgenarten, mit
unterschiedlichen
Persennings und Scheiben und so fort.
Ich möchte aber hier nur
von den
zwei originalen 300 SLS berichten, die jemals im Untertürkheimer
Werk
gebaut wurden.
|

|

|

|
| Abb.
1: Mercedes-Benz 300 SLS Nr. 1 (Werksfoto) |
Abb.
2: O'Shea 1957 in Virginia |
Abb.
3: SLS-Replika von Hans Kleissl in Monterey |
Nachdem vom
Mercedes-Vorstand die Einführung
des 300 SL-Roadsters als Nachfolger des Flügeltürers für
1957 beschlossen war, machte man sich firmenseitig natürlich
auch Gedanken über dessen sportlichen Einsatz. Schließlich
war
das 300 SL Coupé ja in vielen Rennen für Privatfahrer, aber
auch bei vom Werk betreuten Einsätzen recht erfolgreich gewesen.
Und
das verlangte nach einer Fortsetzung.
Da der Roadster aber auf Grund
der Cabriolet-Konstruktion
ein um ca. 40 kg höheres Gewicht hatte und auch die Aerodynamik
schlechter
war, ergaben sich zwangsläufig schlechtere Fahrleistungen, die
sich
auch durch die – jetzt endlich eingeführte – Eingelenk-Pendelachse
nicht komplett wettmachen ließen.
Der Roadster war also mehr ein
sportlicher
Reisewagen, denn ein Rennfahrzeug (Motorklassik Spezial Nr. 3,
Seite
73-77).
Trotzdem zeigte sich Paul
O’Shea, der
die amerikanische Sportwagenmeisterschaft in den Jahren 1955 und 1956
mit
einem 300 SL Coupé gewonnen hatte, bei einem Werksbesuch in
Stuttgart
von dem Fahrverhalten dieses Fahrzeugs ausgesprochen angetan. Das war
Anfang
November 1956, und möglicherweise hatte er bei dieser Gelegenheit
auch den Wunsch nach einem offenen Sportwagen für seine Rennen in
den USA geäußert.
Jedenfalls beschloss der
Vorstand bereits
am 29. November 1956, zwei speziell für den Sporteinsatz in den
USA
präparierte 300 SL Roadster zu bauen und diese zusammen mit
zwei Werksmechanikern dem O’Shea/Tilp-Team zur Verfügung zu
stellen
(Günther/Hübner,
Das große SL-Buch, Seite 35). Da man vorhatte, beide
Fahrzeuge
bereits ab Saisonbeginn 1957 fahren zu lassen, war Eile geboten.
Rennleiter
Uhlenhaut gab am 20.Dezember 1956 in einem Rundschreiben allen
verantwortlichen
Herren der befassten Abteilungen per genauem Terminplan bekannt, welche
Grund-Fahrzeuge der Roadster-Vorserie wann und wie zu behandeln seien.
Als Termin für die erste Probefahrt legte er den 28.März 1957
fest. Die Konstrukteure sollten ihr Hauptaugenmerk auf die
Gewichtsreduzierung
legen und weniger auf Motor- und Fahrwerkstuning. Allerdings wurde die
PS-Zahl doch durch eine Spezial-Sportnockenwelle auf 235 (plus 20
gegenüber
dem 300 SL Coupé) gebracht (Riedner/Engelen, Mercedes Benz
300
SL, Seite 256). Bereits in diesem Schreiben war festgelegt, dass
sich
die beiden Werks-Renner erheblich von einander unterscheiden sollten *. |
| Gegenüber
dem Serien-Roadster
konnte beim Fahrzeug 1 (mit Alu-Karosserie) das Gesamtgewicht um 337 kg
und beim Fahrzeug 2 (mit Stahl-Karosserie) um 167 kg vermindert werden.
Der größte Teil der Gewichtsdifferenz zwischen 1 und 2 lag
natürlich
in der Alu-Karosserie begründet, aber ansonsten gab es auch noch
andere
Unterschiede: So hatte Wagen 1 zwar einen kleinen
Überrollbügel,
aber leichte Sport-Schalensitze, ein Vierspeichen-Sportlenkrad, anstatt
der Lampen nur leichte Abdeckungen und eine verkürzte
Auspuffanlage
(die Endrohre ragten unterhalb der rechten Kiemen aus der Karosserie).
Nur das Armaturenbrett mit allen Instrumenten blieb ebenso wie bei
Wagen
2 serienmäßig. Allerdings behielt dieser auch noch die Sitze
und das Zweispeichen-Lenkrad, den Auspuff und die Lampen aus der Serie.
Bei beiden Versionen wurden leichtere Motoren mit Alu-Gehäuse und
Alu-Tanks eingebaut. Es wurden die Stoßstangen, das Verdeck, die
Seitenfenster und die große Windschutzscheibe entfernt und diese
durch eine kleine rahmenlose Rennscheibe auf einer festen, speziell
geformten
Cockpitabdeckung ersetzt (Ludvigsen, Mercedes-Benz Renn- und
Sportwagen,
Seite 216-217; Günther/Hübner, Seite 36). Im Buch von
Günther/Hübner
sind auf Seite 37 von beiden Versionen jeweils drei sehr
anschauliche
Fotos abgebildet. Beim genauen Betrachten dieser Bilder fragt man sich
aber unwillkürlich: Wieso hat Mercedes-Benz hier nicht die sonst
für
ihre Sportfahrzeuge üblichen Felgen mit Rudge-Zentralverschluss
zum
Einsatz gebracht? Nun, die Erklärung liegt im damaligen Reglement
für amerikanische Sportwagenrennen begründet, und dieses
besagt,
dass das gesamte Rennen ohne Reifenwechsel komplett durchgefahren
werden
musste. Wozu also Felgen für einen schnellen Radwechsel einsetzen? |

Abb. 4 und
5: Wagen 1 (oben) und eine seltene Aufnahme mit beiden SLS
(unten)

|
| Außerdem – aber das
ist jetzt mein
persönlicher Rückschluss aus allen Publikationen über
den
300 SL-Roadster im Allgemeinen und über den SLS im Besonderen –
glaube
ich, dass man bei beiden Renn-Fahrzeugen das äußere
Erscheinungsbild,
mit den Radzierringen, dem gesamten Chromschmuck und dem
Serien-Cockpit,
so nahe wie möglich an das des Serien-300 SL-Roadsters anlehnen
wollte, weil dessen Markteinführung in den USA ja für das
folgende
Jahr 1958 vorgesehen war. Und ich denke, besonders mit der Optik, aber
auch mit den zu erwartenden Rennerfolgen, wollte Daimler-Benz
sicherlich
für entsprechende Publicity sorgen, um bei den potentiellen Kunden
die Kauflust anzuregen. |
 |
Die
Rennerfolge stellten sich
tatsächlich ein, obwohl der SCCA (Sports Car Club of America)
nicht
bereit war, den 300 SLS bereits 1957 als Wagen der
Standard-Production-Kategorie
(Class „C“) anzuerkennen, weil die Fertigung des Serien-Roadsters ja
gerade
erst begonnen hatte und er außerdem eine Alu-Karosserie
besaß.
So musste er in der Special-Sports-Car-Kategorie (Class „D“) gegen so
starke
und rennerprobte Fahrzeuge der 3-Liter-Klasse antreten wie z.B.
Maserati
300S, Ferrari Monza oder Aston Martin DB 3S. Diese waren zwar im
Prinzip
schneller, konnten aber in Bezug auf Standfestigkeit oft nicht mit dem
SLS mithalten. Und da Paul O’Shea bei allen größeren Rennen
der „D“-Klasse mitfuhr, hatte er am Ende der Saison die dreifache
Punktzahl
seines Verfolgers Carol Shelby auf Maserati und somit die
SCCA-Meisterschaft
in dieser Kategorie auch 1957 – im dritten Jahr in Folge – gewonnen (Ludvigsen,
Seite 217; Günther/Hübner, Seite 160). Er hatte mit
beiden
Fahrzeugen an insgesamt 22 Rennen teilgenommen und war dabei 18 Mal in
die Wertung gekommen. Bei den restlichen vier Rennen gab es zwei
Ausfälle
wegen technischer Probleme und zwei Disqualifikationen.
Abb 6:
O'Shea
im Nahkampf (1957)
|
Trotz dieses Erfolgs
beendete Mercedes
nach der Saison 1957 sein Engagement in den USA – offiziell aus
Kostengründen
–, aber sicher auch, um das gerade erworbene, positive Renommee
in
keinster Weise aufs Spiel zu setzen. Victor Gross von Mercedes-Benz of
North America schrieb Folgendes ans Werk in Stuttgart:
„Zusammenfassend kann gesagt
werden, dass
unsere beiden Tourensportwagen im Einsatz gegen ausgesprochene
Rennsportwagen
in den Vereinigten Staaten ein sehr gutes Bild gemacht haben und dass
die
Werbung, die wir mit diesen beiden Wagen getrieben haben, ein voller
Erfolg
gewesen ist.“ (Markt 12/91, Sternschnuppen, Seite 246;
Günther/Hübner,
Seite 161)
Beide Wagen wurden noch im
Jahr 1957 in
den USA verkauft, einer für 5000 $ und der andere für 6000 $
(Olson,
Collecting The Mercedes-Benz SL 1954-1993, Seite 70). 1 $
entsprachen
damals etwas über 4 DM.
Sie galten danach
für Jahrzehnte
als verschollen und „tauchten erst Anfang der 90er Jahre in den USA
wieder
auf". Dies wird jedenfalls im Buch von Baaden/Röcke (Das neue
große
Mercedes SL-Buch) auf Seite 33 behauptet, ohne allerdings etwas
über
die Umstände und den jetzigen Verbleib zu erklären. Bei
Olson,
dessen Informationsstand aber 1993 endet, wird gesagt, dass bis zu
diesem
Zeitpunkt keiner der beiden 300 SLS gefunden wurde. Paul O’Shea erhielt
zwar, laut eigener Aussage, bis zu seinem Tod 1991 jährlich
mindestens
einen Anruf mit der Bitte um Identifizierung eines angeblich
aufgetauchten
Originals, aber alle waren Kopien. Sollten Sie sich an der Suche
beteiligen
wollen, hier sind die Chassis-Nummern: 8467 198 106/2 und 8742 620
070/1. |
| IM HANDEL
ERSCHIENENE MODELLE
1:43, Bausatz
Leider ist mir für dieses
Auto im
Maßstab 1:43 nur ein Modell bekannt. Und zwar von Stefan Wiesel,
einem Kleinstserien-Hersteller aus dem Sauerland, der unter dem
Firmen-Namen
TOPMODELL 43 Mitte der 80er Jahre Resine-Modellbausätze für
einige
Nischenmodelle selbst hergestellt und vertrieben hat.
Der Bausatz besteht nur aus
wenigen Teilen:
Der Karosserie, bei der die typische Cockpitabdeckung fest integriert
ist,
der Bodenplatte mit angegossenen Sitzen, dem Armaturenbrett und
Kleinteilen
(wie Zweispeichenlenkrad, Rädern, Achsen, Auspuffrohr,
Kühlermaske,
Scheinwerferabdeckungen und einem tiefgezogenen Plastikstück als
Scheibe).
Das Ganze gab’s für DM 69,50. Heute würde man diesen damals
recht
hohen Preis sicher gerne bezahlen, wenn man den Bausatz überhaupt
bekommen könnte.
Den Zusammenbau des Kits hielt
wohl selbst
der Hersteller für so unproblematisch, dass er nicht einmal eine
Bauanleitung
beigelegt hatte. Und die ist auch wirklich überflüssig. Die
Teile
passen gut zusammen und Schleifarbeit ist kaum nötig, denn die
Außenhaut
ist relativ glatt und gut gelungen. Ich habe allerdings das
beigefügte
Lenkrad gegen ein authentischeres Vierspeichenlenkrad aus meiner
Ersatzteilkiste
ausgetauscht und anstatt der beigelegten Resine-Räder habe ich
lieber
fertige von einem ausgeschlachteten Hongwell-300 SL-Modell verwendet,
die
machen optisch einfach viel mehr her, weil filigraner. Alle
Chromleisten
sind aus schmalen Streifen selbstklebender Alu-Folie (z.B. „Bare Metal
Foil“ aus dem Zubehörhandel) gefertigt. Als
Überrollbügel
musste ein Bogen einer verchromten Büroklammer herhalten und der
Schriftzug
300 SLS besteht aus zwei 300 SL-Fotoätzsätzen, wobei einer
für
das zweite „S“ zerlegt wurde, um dieses dann an das erste „300 SL“
anzufügen.
Sch..... Arbeit, bei der Größe!! Bis hierher war aber
ansonsten der Zusammenbau mehr oder weniger doch Routine. Und nun kommt
wieder das leidige Thema: Frontscheibe! Das beigefügte Teil war
wegen
der Größe und der Dicke (oder besser Dünne) des
Materials
nicht zu verwenden. Also habe ich mir wieder eine selbst angefertigt.
Als
ich die Scheibe – mit den Spiegeln aus der Ersatzteilkiste –
fertig
und am Modell angebracht hatte, war ich mit dem Ergebnis und dem vor
mir
stehenden gesamten Modell recht zufrieden.
|
 Abb. 7 und
8:
Resine-Bausatz von Topmodell, gebaut vom Verfasser
Abb. 7 und
8:
Resine-Bausatz von Topmodell, gebaut vom Verfasser
 |

|
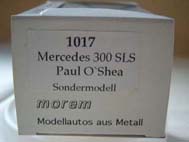
|

|
|
Abb.
9: Morem
SLS neutral (#1016)
|
Abb.
10: Verpackung
von #1017
|
Abb.
11: Morem
SLS Sondermodell O'Shea (#1017)
|
1:87,
Fertigmodelle
Immerhin zwei Modelle des SLS
gab es im
Maßstab HO, beide vom Hersteller Morem. Morem war der
Verkaufsname
einer Kleinserie der Fa. Modellfahrzeuge J. Maier aus Ulm. Modell
Nummer
eins (Bestellnr. 1016) stellt einen neutralen SLS in weiß dar,
Modell
Nummer zwei (Bestellnr. 1017) ging mehr ins Detail und zeigt,
verfeinert
durch Decals und Fahrerfigur, den Wagen, mit dem Paul O'Shea unter der
damals sicher bald gefürchteten Startnummer 30 seine Siege im
Rahmen
der US-Sportwagenmeisterschaften herausfuhr. Beide Modelle sind schon
lange
nicht mehr im Handel und weder für Geld noch für gute Worte
irgendwo
aufzutreiben. |
1:24,
Fertigmodell
Etwas jünger ist der SLS
des Edelherstellers
CMC. Zunächst erschien 1998 eine neutrale Version in
silbergraumetallic
(Bestellnr. MM-014), 1999 folgte eine Version, deren Ausstattung mit
cremeweißer
Lackierung und Startnummer 57 einer Vorbildvariante folgt, die kein
SLS,
sondern ein umgebauter Roadster war (MM-017). Beide Modelle bestechen,
wie von CMC gewohnt, durch ihren extremen Detailreichtum und die
solide,
schwere Qualität.
Bei MM-014 läßt
sich im Gegensatz
zu MM-017 neben den Türen und der Motorhaube auch der
Kofferraumdeckel
öffnen, was bei MM-017 wegen der den Überrollbügel
integrierenden
und weit nach hinten reichenden Lufthutze nicht möglich ist. Beim
SLS ist der Beifahrersitz abgedeckt, und die niedrige Frontscheibe
entspricht
in ihrer Breite gerade dem Bedarf des Fahrers. Der Roadster mit
Startnummer
57 ist für einen Beifahrer eingerichtet, die Abdeckung fehlt und
es
wurde eine beide Sitzplätze schützende breite
Windschutzscheibe
verwendet, inclusive der dazu passenden im Modell extrem filigranen
Scheibenwischer.
Im Gegensatz zum SLS ist der Wagen mit Rudge-Zentralverschluss
ausgerüstet.
Gefahren wurde der Umbau-Roadster von Mark Brown.
Beide Modelle waren wegen des
weniger
beliebten Maßstabs nicht unbedingt Verkaufsrenner, sind aber
inzwischen
längst nicht mehr erhältlich. Hier und da taucht mal ein
Exemplar
bei Ebay auf, und wenn man Glück hat, zahlt man weniger dafür
als der damalige Erstbesitzer. |

Abb. 12 und
13: 300
SLS von CMC - MM-014 (oben), und Roadster MM-017 (unten)
 |
* Nachtrag
2008: Im Licht
aktuellerer Kenntnisse muß mittlerweile angezweifelt werden, ob
sich
die beiden Exemplare gewichtsmäßig unterschieden haben.
Vieles
spricht dagegen, wie Autor Hajo Lütke auch in einer
Veröffentlichung
im MBMC-Journal 2/2008 einräumt. So hatten wohl beide SLS eine
Aluminium-Karosserie,
und die hier beschriebenen Unterschiede in der Ausstattung haben ihren
Ursprung in einer weitverbreiteten fälschlichen Bildzuordnung (in
der ersten Version dieser Seite war ein solches Foto abgebildet) eines
weißen Roadsters mit dem deutschen Kennzeichen S - DC 208, der
dem
SLS recht ähnlich sah. Dr. York Seifert gebührt der
Verdienst,
diesen Irrtum aufgeklärt zu haben, als er langwierige Recherchen
im
Mercedes-Benz-Werksarchiv für die Erstellung des SLS-Sonderhefts
durchführte,
welches der Mercedes-Benz 300 SL Club aufgelegt hat.
Ein weitere
Ergänzung
betrifft die Modelle des SLS: der MBMC hat ein SLS-Modell in 1:43 als
Club-Jahresmodell
2008 in einer Kleinserie bei Tin Wizard auflegen lassen.
(Gunter Klug,
Sommer 2008) |

Abb. 14:
Cockpit
des SLS Nr. 1 |
Dieser Text erschien
zuerst im Club-Journal Nr. 4/2006 des Mercedes-Benz
Modellauto-Club (MBMC) und wird hier leicht verändert
wiedergegeben.
Ich danke Hajo Lütke für die Genehmigung zur
Veröffentlichung
auf der 300-SL-Homepage.
Quellen:
Riedner/Engelen:
Mercedes-Benz
300 SL - Vom Rennsport zur Legende, Motorbuch-Verlag,
Stuttgart
1999
Baaden/Röcke:
Das
neue große Mercedes SL-Buch, Heel-Verlag, Königswinter
2002
Günther/Hübner:
Das
große Mercedes SL-Buch, Heel-Verlag, Königswinter
1988
Ludvigsen: Mercedes
Benz
Renn- und Sportwagen, Bleicher-Verlag, Gerlingen 1982
Olson: Collecting
the
Mercedes-Benz SL 1954 - 1993, 1993
Motor Klassik
Spezial Nr.3:
Alles
über die klassischen Mercedes SL, Stuttgart 1988
Markt 12/91: Sternschnuppen
SLS-Sonderheft
des 300-SL-Clubs,
2007
Copyrights:
Hajo
Lütke (Text, Abb.
7, 8)
Mercedes-Benz
Werksarchiv
(Abb. 1, 4, 14)
Ralf-Otto
Pferdmenges (Foto
300-SL-Schriftzug am Seitenanfang)
Reinhard
Lappöhn (Abb.
9, 10, 11)
Mercedes-Benz
300 SL Club
(Abb. 5)
www.mb300sl.de
(Layout)
|
|

